Die Absetzung für Abnutzung (kurz AfA) bezeichnet die steuerlich relevante Wertminderung sämtlicher Wirtschaftsgüter während Ihrer wirtschaftlichen Nutzungsdauer. Beispielsweise können die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Immobilien, verteilt auf die wirtschaftliche Nutzungsdauer des Gebäudes, steuerlich abgesetzt werden.
Optimiere die jährliche Abschreibung und
Besteuerung deiner Immobilie
Das geht über die tatsächliche Nutzungsdauer: Für welche
Immobilie möchtest du sie berechnen?
- Ersteinschätzung direkt online
- in wenigen Minuten fertig
- 100% kostenlos & unverbindlich

Durch die stetige Abnutzung entsteht eine Wertminderung der Immobilie. Mit der Absetzung für Abnutzung (AfA) kann der dadurch entstandene Kapitalverlust steuerlich abgesetzt werden.
AfA kann nicht für selbst bewohntes Wohneigentum in Anspruch genommen werden.
Entdecke passende Immobilienangebote bis zu 24 Stunden früher als andere Suchende. Mit SuchenPlus für Käufer erhöhst du deine Chancen auf deine Traumimmobilie.
- Was bedeutet „Absetzung für Abnutzung" von Gebäuden?
- Warum gibt es AfA?
- Wie funktioniert die AfA?
- Absetzung für Abnutzung bei Altbauten
- Absetzung für Abnutzung für Modernisierungen
- Welche Kosten können bei der Abschreibung steuerlich geltend machen?
- Abschreibungsmöglichkeiten bei Neubauten
- Abschreibungsmöglichkeit Denkmalschutz
- Ist die degressive Abschreibung möglich?
- FAQ zu Absetzung für Abnutzung für Gebäude
Die „Absetzung für Abnutzung“ (AfA) ist ein Begriff aus dem Steuerrecht. Es geht darum, die Kosten für ein Gebäude über dessen Nutzungsdauer hinweg steuerlich geltend zu machen. Mit anderen Worten: Du kannst jedes Jahr einen Teil der Anschaffungs- oder Herstellungskosten deines Gebäudes als Betriebsausgabe oder Werbungskosten absetzen. So wird der Wertverlust des Gebäudes über die Jahre verteilt.
Gebäude nutzen sich im Laufe der Zeit ab. Sie altern, werden renovierungsbedürftig und verlieren an Wert. Die AfA berücksichtigt diesen Wertverlust und erlaubt es dir, die Abnutzung steuerlich geltend zu machen. Das ist besonders wichtig für Vermieter und Unternehmer, die Immobilien besitzen und deren Nutzungskosten realistisch abbilden möchten.
Spare Steuern dank
Nutzungsdauer-Gutachten
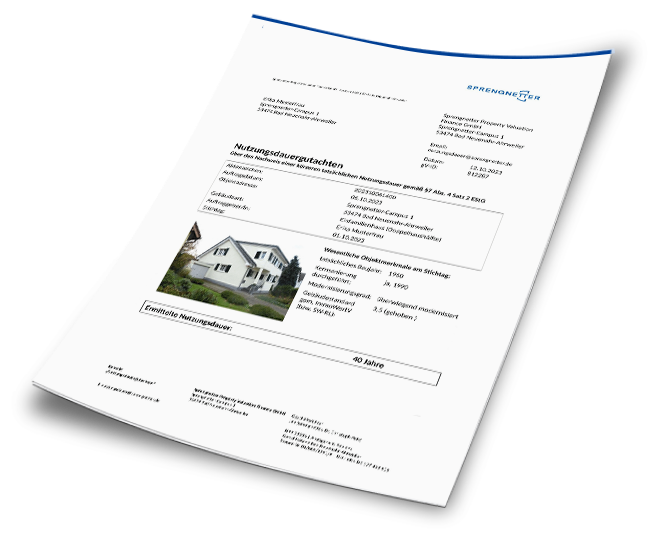
Schon gewusst? Mit einem Nutzungsdauer-Gutachten kannst du die jährliche Abschreibung deiner Mietimmobilie beim Finanzamt erhöhen und somit Steuern sparen.
![]() bequem︎ & schnell online anfordern
bequem︎ & schnell online anfordern
![]() für die Vorlage beim Finanzamt
für die Vorlage beim Finanzamt
![]() von zertifizierten Sachverständigen erstellt
von zertifizierten Sachverständigen erstellt

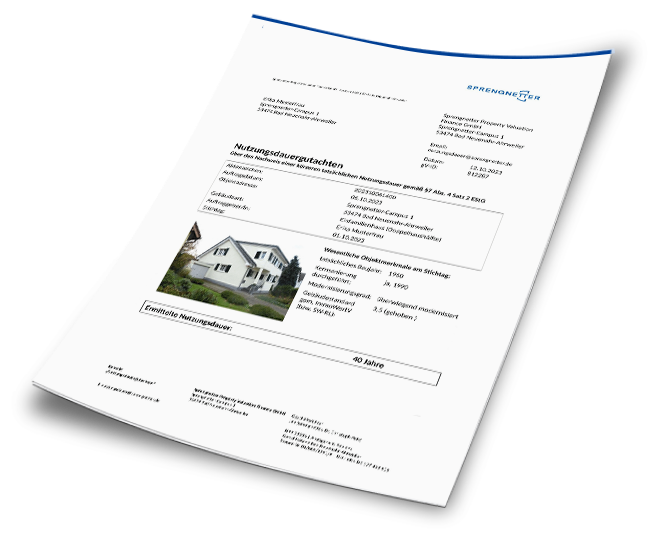
Die Höhe der AfA hängt von der Art des Gebäudes und dessen Nutzung ab. Für Wohngebäude gibt es zum Beispiel andere Abschreibungssätze als für gewerblich genutzte Gebäude. In Deutschland wird häufig eine lineare Abschreibungsmethode angewendet. Das bedeutet, dass jedes Jahr ein gleichbleibender Prozentsatz der Anschaffungskosten abgesetzt wird.
- Wohngebäude: Hier beträgt die jährliche Abschreibung in der Regel zwei Prozent der Anschaffungskosten über 50 Jahre.
- Gewerbliche Gebäude: Für diese kann der AfA-Satz je nach Nutzungsdauer variieren. Oftmals liegt er bei drei Prozent jährlich über 33 Jahre.
Schon gewusst? So wird die AfA berechnet Nehmen wir an, du hast ein Wohngebäude für 300.000 Euro gekauft. Jährlich kannst du dann zwei Prozent von 300.000 Euro absetzen, also 6.000 Euro pro Jahr. Dieser Betrag wird als Betriebsausgabe oder Werbungskosten von deinem steuerpflichtigen Einkommen abgezogen.

Für Altbauten gelten ähnliche Regeln wie für Neubauten, jedoch gibt es einige Besonderheiten:
- Abschreibungssatz: Bei Gebäuden, die vor 1925 erbaut wurden, kannst du jährlich 2,5 Prozent der Anschaffungskosten über 40 Jahre abschreiben. Bei jüngeren Altbauten (nach 1925 erbaut) sind es zwei Prozent über 50 Jahre.
- Kaufpreisaufteilung: Der Kaufpreis eines Altbaus muss in Boden- und Gebäudewert aufgeteilt werden, da nur der Gebäudewert abgeschrieben werden kann.

Was du beachten solltest Halte alle Kosten und Maßnahmen detailliert fest, um sie bei der Steuer geltend machen zu können. Ein:e Steuerberater:in kann dir helfen, die bestmöglichen steuerlichen Vorteile zu nutzen und alle Regelungen korrekt anzuwenden.
Du hast dein Haus oder deine Wohnung modernisiert und fragst dich nun, wie du die Kosten steuerlich geltend machen kannst? Die Absetzung für Abnutzung (AfA) bietet dir die Möglichkeit, Modernisierungskosten über die Jahre hinweg abzusetzen. Doch Vorsicht: Nicht alle Modernisierungen sind gleich. Hier sind einige Beispiele für Maßnahmen, die du absetzen kannst:
- Energetische Sanierungen: Austausch von Fenstern, Dämmung der Fassade oder des Daches, Installation von Solaranlagen.
- Modernisierung von Heizung und Sanitär: Neue Heizungsanlagen, Erneuerung von Sanitärinstallationen.
- Wohnwertverbessernde Maßnahmen: Einbau eines neuen Badezimmers, Renovierung der Küche, Balkonanbau.
Abschreibung bedeutet, dass du den Wertverlust eines Wirtschaftsguts, wie einer Immobilie, über dessen Restnutzungdauer hinweg steuerlich absetzen kannst. Dadurch verteilst du die Kosten auf mehrere Jahre und reduzierst dein zu versteuerndes Einkommen. Notwendig dafür ist ein Restnutzungsdauer Gutachten.
| Kosten | Details |
| Anschaffungskosten | Die Anschaffungskosten umfassen den Kaufpreis der Immobilie sowie alle direkt zuordenbaren Nebenkosten. Dazu gehören: - Kaufpreis der Immobilie - Notarkosten - Grunderwerbsteuer - Maklergebühren - Gutachterkosten Diese Kosten können über die Nutzungsdauer der Immobilie abgeschrieben werden. Bei Wohngebäuden beträgt der Abschreibungssatz in der Regel zwei Prozent pro Jahr, bei gewerblich genutzten Gebäuden drei Prozent pro Jahr. |
| Herstellungskosten | Herstellungskosten entstehen bei der Errichtung eines Neubaus oder bei wesentlichen Erweiterungen und umfassen: - Baukosten (Material- und Arbeitskosten) |
| Modernisierungskosten | Modernisierungskosten Modernisierungskosten fallen an, wenn du die Immobilie auf einen höheren Standard bringst. Dazu zählen: - Energetische Sanierungen (z.B. neue Fenster, Dämmung) - Erneuerung der Heizungsanlage - Ausbau des Dachgeschosses Solche Kosten können oft über mehrere Jahre verteilt abgeschrieben werden. |
| Erhaltungsaufwand | Erhaltungsaufwand dient dazu, den bestehenden Zustand der Immobilie zu erhalten. Typische Beispiele sind: - Reparaturen (z.B. Dachreparatur, Austausch von Heizungsanlagen) - Wartungsarbeiten - Malerarbeiten Diese Kosten kannst du in der Regel sofort im Jahr der Entstehung als Werbungskosten oder Betriebsausgaben absetzen. |

Es gibt Sonderabschreibungen Neben den regulären Abschreibungen gibt es auch Sonderabschreibungen, die zusätzliche steuerliche Vorteile bieten: Für den Neubau von Mietwohngebäuden können etwa unter bestimmten Voraussetzungen in den ersten vier Jahren bis zu 20 Prozent der Anschaffungs- oder Herstellungskosten zusätzlich abgeschrieben werden.
Du planst den Bau eines neuen Hauses oder hast gerade ein Neubauprojekt abgeschlossen? Für Neubauten von Wohngebäuden beträgt der jährliche Abschreibungssatz in der Regel zwei Prozent. Das bedeutet, dass du die Kosten über 50 Jahre hinweg abschreiben kannst.
Beispiel:
Du baust ein Wohngebäude für 400.000 Euro. Jährlich kannst du zwei Prozent von den Herstellungskosten abschreiben, also 8.000 Euro.

Abschreibungsmöglichkeiten bei Gewerbegebäude: Für Neubauten von gewerblich genutzten Gebäuden beträgt der Abschreibungssatz drei Prozent. Du kannst die Kosten über 33 Jahre hinweg abschreiben.
Wenn du eine denkmalgeschützte Immobilie besitzt oder planst, eine zu erwerben, gibt es spezielle Abschreibungsmöglichkeiten, die dir erhebliche steuerliche Vorteile bieten können. Der Gesetzgeber weiß: Die Erhaltung denkmalgeschützter Gebäude ist oft mit erheblichen Kosten verbunden. Um Eigentümer:innen zu entlasten und Anreize für die Sanierung solcher Immobilien zu schaffen, gibt es spezielle steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten. Diese erleichtern die Finanzierung und fördern den Erhalt der historischen Substanz.
| Abschreibbare Kosten | |
| Abschreibung der Anschaffungskosten | Die Anschaffungskosten einer denkmalgeschützten Immobilie können wie bei normalen Gebäuden abgeschrieben werden. Hierbei gilt in der Regel die lineare Abschreibung. - Wohngebäude: Zwei Prozent jährlich über 50 - Jahre |
| Abschreibung der Sanierungskosten | Die Sanierungskosten sind die wichtigsten Abschreibungsposten bei denkmalgeschützten Immobilien. Diese Kosten können in erhöhtem Maße steuerlich geltend gemacht werden. - Bei Vermietung: Du kannst die Sanierungskosten über 12 Jahre abschreiben: Acht Jahre lang neun Prozent und danach vier Jahre lang sieben Prozent. Zusätzlich zu den regulären Abschreibungen kannst du unter bestimmten Voraussetzungen Sonderabschreibungen geltend machen. Diese variieren je nach Bundesland und Förderprogramm.
|

Was musst du beachten? Alle Sanierungsmaßnahmen müssen mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt und genehmigt werden.
Die degressive Abschreibung ist eine Methode, bei der du in den ersten Jahren höhere Abschreibungsbeträge ansetzen kannst, die dann über die Nutzungsdauer des Wirtschaftsguts abnehmen. Bei Immobilien ist eine degressive Abschreibung nicht möglich. Die Regel bei Gebäuden ist eine lineare Abschreibung. Was ist der Unterschied zwischen einer degressiven und einer linearen Abschreibung?
Degressive Abschreibung:
- Höhere Abschreibungsbeträge in den ersten Jahren
- Geringere Abschreibungsbeträge in den späteren Jahren
- Vorteilhaft, wenn du schnell hohe steuerliche Entlastungen benötigst
Lineare Abschreibung:
- Gleichbleibende Abschreibungsbeträge über die gesamte Nutzungsdauer
- Planbare und konstante steuerliche Entlastung
FAQ zu Absetzung für Abnutzung für Gebäude
-
Was bedeutet Absetzung für Abnutzung für Gebäude?
-
Die Absetzung für Abnutzung (AfA) für Gebäude erlaubt es, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Gebäudes über dessen Nutzungsdauer hinweg steuerlich abzuschreiben. Dies bedeutet, dass jedes Jahr ein fester Prozentsatz der Kosten als Werbungskosten oder Betriebsausgaben abgesetzt werden kann. So wird der Wertverlust des Gebäudes berücksichtigt und die Steuerlast entsprechend gesenkt.
-
Wie hoch ist die AfA bei gebrauchten Immobilien?
-
Bei gebrauchten Immobilien beträgt die AfA in der Regel zwei Prozent der Anschaffungskosten pro Jahr für Wohngebäude, was einer Abschreibungsdauer von 50 Jahren entspricht. Handelt es sich um gewerblich genutzte Immobilien, liegt der Abschreibungssatz bei drei Prozent pro Jahr, was einer Dauer von etwa 33 Jahren entspricht. Die genaue Höhe der AfA hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter das Baujahr und die Art der Nutzung des Gebäudes.
-
Wie hoch ist die Afa bei denkmalgeschützen Gebäuden?
-
Die AfA bei denkmalgeschützten Gebäuden ist besonders attraktiv und erlaubt erhöhte Abschreibungssätze für die Sanierungskosten. Die Sanierungskosten bei Vermietung können über 12 Jahre abgeschrieben werden. Bei Eigennutzung können Sanierungskosten zwar nicht als Werbungskosten abgesetzt werden, aber es gibt oft Förderungen und Zuschüsse für denkmalgeschützte Gebäude.

Als Immobilienexpertin und Redakteurin bei ImmoScout24 informiert dich Oranus Mahmoodi über alle Themen rund ums Mieten und Kaufen. Oranus ist studierte Journalistin und Soziologin. Sie beobachtet die Immobilienwirtschaft seit Jahren. Ihre Expertise als Wirtschafts- und Finanzjournalistin hat sie bei Financial Times Deutschland gewonnen, wo sie über viele Jahre gearbeitet hat. Als Autorin für Nachrichtenagenturen und diverse Wirtschaftstitel hat sie sich intensiv mit allen Seiten der Immobilienwirtschaft beschäftigt. Ihr Credo ist es, komplexe Themen für dich unterhaltsam und verständlich aufzubereiten.
Bitte beachte: Oranus Mahmoodi ist Immobilienexpertin, jedoch keine Immobilienmaklerin. Sie kann keine Immobilien vermitteln oder Anfragen dieser Art beantworten. Wende dich hierfür bitte an die jeweiligen Anbieter oder unseren Support.
Die ImmoScout24 Redaktion verfasst jeden Beitrag nach strengen Qualitätsrichtlinien und bezieht sich dabei auf seriöse Quellen und Gesetzestexte. Unsere Redakteur:innen haben ein hohes Niveau an Immobilienwissen und informieren dich als Expert:innen mit informativen und vertrauenswürdigen Inhalten. Wir verbessern und optimieren unsere Inhalte kontinuierlich und versuchen, sie so leserfreundlich und verständnisvoll wie möglich für dich aufzubereiten. Unser Anliegen ist es dabei, dir eine erste Orientierung zu bieten. Für persönliche Anfragen deiner rechtlichen oder finanziellen Anliegen empfehlen wir dir, eine:n Rechts-, Steuer-, oder Finanzberater:in hinzuzuziehen.
 Ähnliche Artikel
Ähnliche Artikel





„Mit der AfA können Immobilienbesitzer:innen ihre Steuerlast effektiv senken, deshalb sollten sie sich gut über die Optionen informieren“